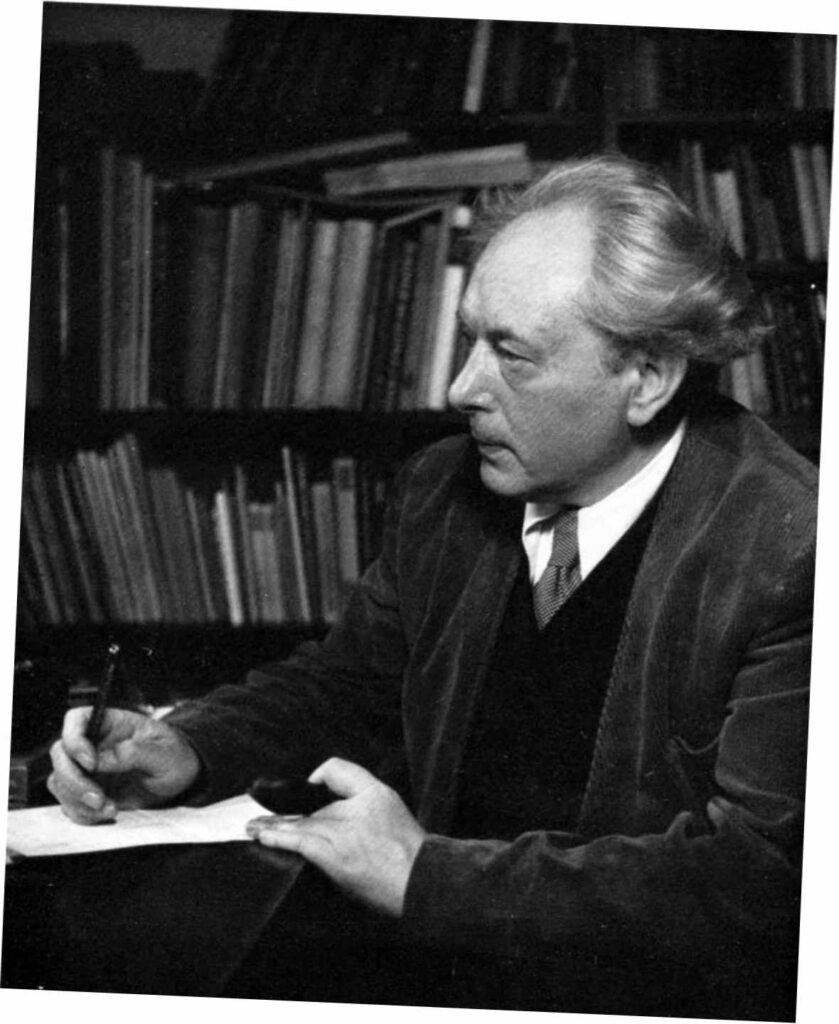
Eine Begegnung an einem kalten regnerischen Dezembertag 1952 in der Große Bleichen mit einen sehr pessimistischen „Carolus“, wie Carl Albert von seinen Freunden genannt wurde. R. Italiaander erinnert sich 1984 in „Carl Albert Lange – ein zu Unrecht vergessener Hamburger Lyriker“:
„Er trug einen dunkelblauen Wintermantel und seine etwas zu kleine Baskenmütze, die typisch für ihn war. Die Hände hatte er in den Manteltaschen vergraben. Er wirkte wie in ein Schneckenhaus zurückgezogen.
Eine Zeitlang gingen wir wortlos nebeneinander her. Langes Gesicht war von der Kälte rot, die Augen merkwürdig glasig-blau. Er wirkte auf mich, als nehme er die reale Welt gar nicht wahr.
Immer war er höflich, freundlich, charmant. Kaum an diesem Tage. Vielmehr war er verbittert. … Ich sprach ihn auf seine letzte Erkrankung an. Barsch meinte er: ‚Ist ja alles nicht wichtig!‘ Das kpnne man nicht sagen, entgegnete ich; denn das Leben oder Sterben hinge doch davon ab.
Er blieb stehen und sagte verdrossen: ‚Warum eigentlich noch bleiben? Ich habe es satt. Es ist alles so sinnlos.‘
Er attackierte Hamburger Schriftsteller- und Künstlerverbände und die Kulturbehörde.
Mir war meine Hilflosigkeit dem verzweifelten Mann gegenüber höchst unangenehm. Ich behauptete, es müßte doch auch für ihn Lösungen geben. Da sagte er: ‚Das nächste Mal werde ich etwas anderes. Ich bin des Schreibens leid!‘
Doch machte er einigen Hamburger Kollegen respektvoll Komplimente und fuhr dann fort: ‚Ich habe nun tausende Seiten vollgeschrieben. Warum eigentlich? Kannst Du mir das sagen?‘
Es blibe im Verkehrsgetriebe stehen, schaute mich streng an, seine Stimme und seine Haltung waren beinahe inquisitorisch:
‚Weißt Du, in einem großen Orchester sind immer welche bestimmt, die zweite oder dritte Geige zu spielen. In der Jugend streben sie nach dem Platz des Primgeigers. Aber all das Streben nutzt gar nichts. Auch bei der Geigerei ist alles Bestimmung. Sind das nun kluge Leute, so geben sie es eines Tages auf, sie bescheiden und freuen sich, daß sie überhaupt mitspielen dürfen.
Und dazu habe ich mich nun durchgerungen – wenn du fragst, warum ich so resigniert bin. Streben ist ja schön, aber weißt du, ohne die Sterne … nee, das geht eben nicht!‘
Ich hakte mich bei ihm unter, was damals nicht so üblich war wie heute. Wir machten Scherze über Rimbaud und Verlaine.
Für Sekunden war er wieder der alte Lebsnkünstler. und doch verloren seine Augen das glasige Fremde nicht. ‚Du hörst ja gar nicht zu, Carolus‘ sagte ich. Schließlich trennten wir uns. Er fuhr nach Hause.
Am nächsten Tag rief ich bei ihm zu Hause an. Seine Frau sagte, er sei erkrankt und nicht ansprechbar.
Am Tag darauf kam er ins Krankenhaus.
Sein Gang mit mir über den Jungfernstieg war sein letzter durch die Heimatstadt Hamburg, die er so liebte.
Am Freitag, den 5. Dezember 1952 schrieb er im vollen Bewußtsein seines nahen Todes diese Verse:
'Lebt wohl, geliebte Hände, es naht euch nun das Ende, eint euch dem Erdenstaube. Lebt wohl, geliebte Füße, dem Staube bringet Grüße von einem, der nun Taube. Lebt wohl, mein Hirn, in feinen Schlieren seh' ich ins Blau dich mir verlieren, du warst mir eine volle Traube.'
„Drei Tage später starb er nach einem Anfall von Angina pectoris …“
Grabstein, nach einem Entwurf von Charlotte Rodewald-Thiede